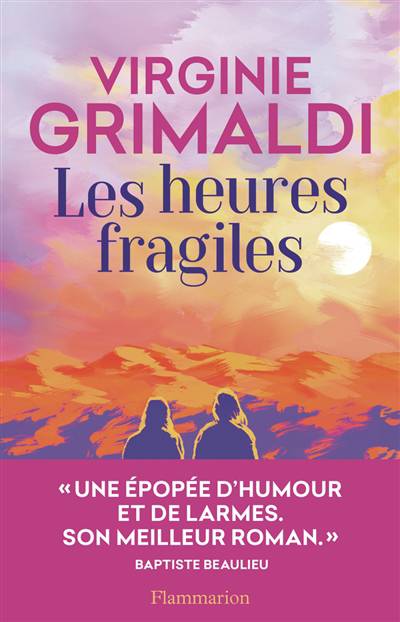- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Der Sündenfall in der Philosophie des Deutschen Idealismus - Kant, Schelling, Hegel
Markus Renner
Livre broché | Allemand
23,45 €
+ 46 points
Description
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, Note: sehr gut (1), Ruhr-Universität Bochum (Institut für Philosophie), Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung In der vorliegenden Arbeit wird der biblische Sündenfall in der Philosophie des Deutschen Idealismus untersucht, genauer gesagt bei drei großen Vertretern dieser Epoche: Kant, Schelling und Hegel. Während Kant einen Grenzfall, sowohl zeitlich, als auch inhaltlich, zwischen Aufklärer und Idealist darstellt und der Begründer des transzendentalen Idealismus ist, gelten Schelling und Hegel zusammen mit Fichte, der in dieser Arbeit keine Rolle spielen wird, als Hauptvertreter des absoluten Idealismus, der in die Philosophiegeschichte unter der Bezeichnung "Deutscher Idealismus" Einzug gehalten hat. Merkmale des Deutschen Idealismus sind, dass sich die Subjektivität als das Absolute begreift. Dies bedeutet, dass die Idee nicht als Bedingung der Handlung gesehen wird, sondern die Handlung selbst ist die Idee. Damit wird über die Erkenntnistheorie hinaus eine neue pantheisierende Metaphysik grundgelegt. Der Idealismus setzt die Wesensordnung, die alles Einzelne umfasst und bemisst, als sich selbst umgreifendes Ganzes voraus und ist somit an vielen Punkten im Hinblick auf die Wirklichkeit nicht realistisch, da er versucht, ein geschlossenes System in der Welt zu erzwingen, was nicht zu bewerkstelligen ist. Der Idealismus versucht das Ideal zu erreichen, ein System, das alles in sich zu vereinen und zu erklären versucht, wobei Geschichte in diesem Denken eine große Rolle spielt. Sie verläuft nicht zufällig so wie sie sich uns darbietet, sondern ist die Selbstverwirklichung einer absoluten Idee, die aber dennoch dem Menschen Freiheit in seiner Welt lässt. Der Widerspruch, der sich hieraus ergibt, ist das Problemfeld, das der Deutsche Idealismus bearbeitet. Der Sündenfall als solcher wird von drei Philosophen mit unterschiedlichen Schwerpunkten untersucht. Der Mo
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 28
- Langue:
- Allemand
Caractéristiques
- EAN:
- 9783638882729
- Date de parution :
- 07-01-08
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 140 mm x 216 mm
- Poids :
- 45 g

Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.