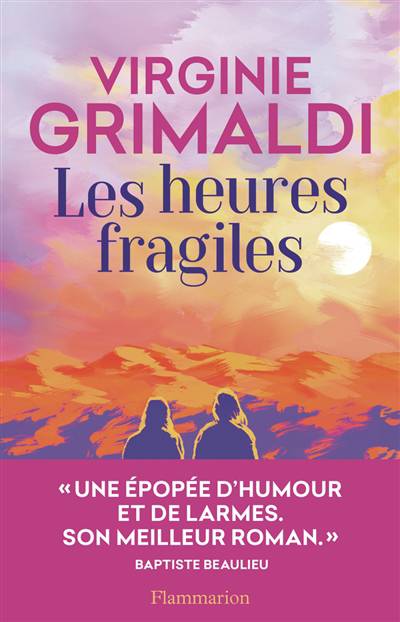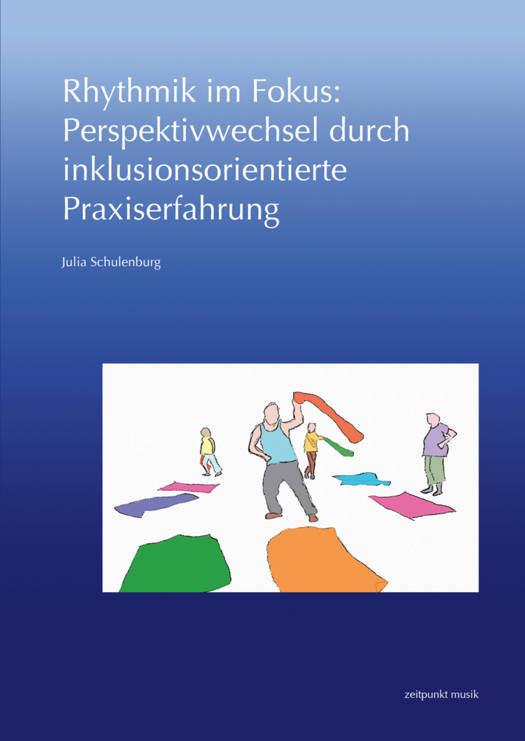- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
31,45 €
+ 62 points
Description
Marie Elisabeth "Mimi" Scheiblauer beginnt bereits in den 1920er Jahren ihre rhythmische Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ihr Menschenbild ist dabei von Wertschatzung gepragt. Dennoch ist das gemeinsame Musizieren mit Menschen mit Behinderung ohne therapeutische Absichten bis heute keine Selbstverstandlichkeit. Mit den in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen festgeschriebenen Rechten auf Bildung und auf kulturelle Teilhabe hat sich Deutschland verpflichtet, jedem Menschen Zugang zu Bildung und Kultur zu ermoglichen. Dafur braucht es jedoch einen Strukturwandel an Bildungsinstitutionen. Hochschulbildung im Kontext von Inklusion beinhaltet also mindestens zwei Facetten: Erstens die Vorbereitung angehender padagogischer Fachkrafte auf veranderte Zielgruppen und zweitens die Anerkennung von Menschen mit Beeintrachtigung als gleichberechtigte Teilnehmende an Lehrveranstaltungen. Die Hochschulrektorenkonferenz und der Verband deutscher Musikschulen erklaren folgerichtig: Die Lehrenden mussen sich im Rahmen ihrer Lehrtatigkeit auf veranderte Zielgruppen in den Seminaren einstellen und ihre Studierenden auf eben jene Wandlung im Hinblick auf ihre (zukunftige) Lehrtatigkeit vorbereiten. Zahlreiche Erfahrungsberichte aus musikpadagogischen Projekten zeugen von einzigartigen Erfahrungs- und Entfaltungsraumen bei Projekten mit inklusiver Ausrichtung.Die Wirkung solcher Angebote auf Studierende des Lehramts ist bereits mehrfach wissenschaftlich erforscht. Weitestgehend unbekannt ist jedoch die Sicht der Musikhochschulstudierenden, die beispielsweise mit einem kunstlerischen Schwerpunkt studieren oder als Instrumental- und Gesangspadagoginnen und -padagogen an einer Musikschule tatig werden. Auch fehlt bislang ein Perspektivwechsel auf fachliche Qualifikationen, gemeint im Hinblick auf kunstlerische und padagogische Befahigungen. Bisherige Forschungsarbeiten untersuchen zumeist Fragen, die im direkten Zusammenhang mit dem Inklusionsbegriff stehen, also beispielsweise die personliche Einstellung zu Menschen mit Behinderung oder zu Inklusion. Die als Triangulation durchgefuhrte qualitative Studie beantwortet die Frage nach Entwicklungspotentialen in den Themenfeldern Padagogik, Inklusion und kunstlerisches Schaffen durch Besuch eines inklusionsorientierten Hochschulseminars der Rhythmik/Musik und Bewegung. Damit werden grundlegende Forschungslucken geschlossen. Zum einen nimmt sie einen Perspektivwechsel auf Musikhochschulstudierende ohne (offensichtliche) Beeintrachtigung und ohne Lehramt als Fach vor. Zum anderen erganzt sie einen fachlichen Fokus, indem die Perspektive um die Frage nach kunstlerischen Qualifikationen erweitert wird. Damit soll ein weiterer Schritt auf dem Weg zur selbstverstandlichen Musizierpraxis von Menschen mit und ohne Behinderung an Hochschulen geschaffen werden.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 250
- Langue:
- Allemand
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9783752008777
- Date de parution :
- 19-08-25
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 170 mm x 13 mm
- Poids :
- 485 g
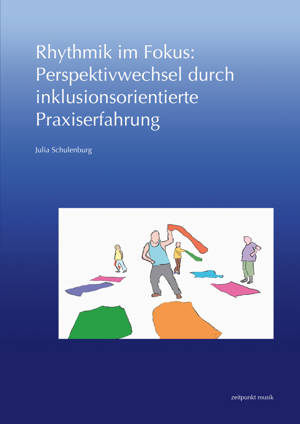
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.